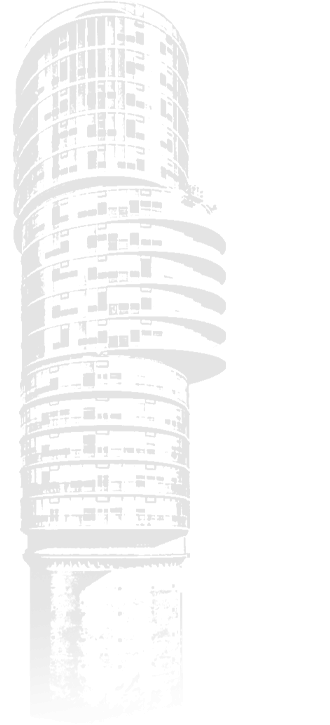
Mietrecht Bochum
Kündigung
Kündigungsgründe im Mietrecht
Zum Schutz des Wohnraummieters kann der Vermieter nur bei berechtigtem Interesse ordentlich kündigen, § 573 BGB. Der vertragstreue Mieter soll so vor willkürlichen Kündigungen und dem Verlust seines Lebensmittelpunktes geschützt werden (so Begründung in der Bundestagsdrucksache 7/2011). Die Regelung ist nach herrschender Meinung verfassungskonform, wenn sie auch im Einzelfall zu unangemessenen Ergebnissen führen kann.
Ausnahmen vom Erfordernis des berechtigten Interesses
- Wohnraum, der nur für vorübergehenden Gebrauch vermietet ist;
- wenn der Wohnraum Teil einer vom Vermieter bewohnten Wohnung ist und vom Vermieter möbliert vermietet ist, es sei denn, es ist an eine Familie zum dauernden Gebrauch vermietet;
- Wohnraum, der Teil eines Studenten - oder Jugendwohnheims ist
- wenn das Haus nur zwei Wohnungen aufweist und eine davon vom Vermieter bewohnt wird
Hier braucht der Vermieter kein berechtigtes Interesse nachweisen, vgl. § 573 a BGB, dafür verlängern sich die Kündigungsfristen.
Zahlungsverzug
Kommt der Mieter mit der Mietzahlung für zwei Monate in Rückstand, § 543 Abs. 3 BGB, so ist der Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigt.
Andere Pflichtverletzungen des Mieters
Als berechtigtes Interesse des Vermieters zur Kündigung wird anerkannt, wenn der Mieter seine mietvertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt, § 573 Abs.2 S.1 BGB. Entscheidend ist, ob die Vertragsverletzung durch den Mieter den Vermieter in seinen Belangen so beeinträchtigt, dass die Kündigung als angemessene Reaktion erscheint. Hierbei sind die Umstände des Einzelfalls zu bewerten.
Je nach Schwere des Vertragsverstoßes kann bereits der einmalige Vertragsverstoß die Kündigung rechtfertigen. Im Regelfall wird dem Vermieter aber anzuraten sein, den Mieter abzumahnen, also auf die Vertragswidrigkeit seines Tuns oder Unterlassens hinzuweisen.
Insoweit hat die Abmahnung eine Klarstellungsfunktion.
Der Mieter muss in der Regel schuldhaft gehandelt haben, leichte Fahrlässigkeit kann bereits genügen. Der Mieter hat sich auch das Verschulden von Untermietern oder bei ihm wohnenden Personen zurechnen zu lassen. Leben mehrere Mieter in einer Wohnung, reicht es aus, wenn der Kündigungsgrund in einem der Mieter besteht. Falls eine Abmahnung vor Kündigung erforderlich ist, muss sie dann aber allen Mitmietern gegenüber ausgesprochen werden.
Beispiele:
- Ständige Verstöße gegen die Hausordnung;
- ständig unpünktliche Zahlungsweise;
- Zahlungsverzug, wobei die Voraussetzungen des § 554 BGB nicht vorliegen müssen, andererseits darf es sich auch nicht um eine völlig unerhebliche Summe handeln;
- Überlassung des Wohnungsgebrauchs an Dritte ohne Zustimmung des Vermieters;
- Überlassung des Wohnungsgebrauchs an Dritte ohne Wissen des Vermieters;
- Verstoß gegen wirksames Haustierhaltungsverbot;
- Häufige Störung des Hausfriedens;
- Vorsätzliche Beschädigung der Mietsache;
- Unterlassung von Schönheitsreparaturen, zumindest bei Gefahr für die Mietsache; Nachhaltige Unterlassung der Gartenpflege;
- Vertragswidrige Überbelegung der Wohnung;
- rechtsirrtümliche (teilweise) Zurückbehaltung des Mietzinses aufgrund angeblicher Minderungsansprüche, der Mieter muss sich hierbei auch ein Verschulden seines Rechtsberaters (Mieterverein, Anwalt etc.) anrechnen lassen, jedoch nicht, wenn seine vertretene Ansicht zur damaligen Zeit der herrschenden Meinung entsprach.
Vorherige Abmahnung erforderlich?
Noch bis vor Kurzem war wie Frage streitig, ob eine Abmahnung des Vermieters oder Mieters bei ordentlicher Kündigung - also keine fristlose Kündigung - erforderlich war oder nicht. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung vom 28. November 2007, Aktenzeichen VIII ZR 145/07, klargestellt, dass eine Abmahnung wegen z. B. vertragswidrigen Verhaltens nicht unbedingt Voraussetzung für eine ordentliche Kündigung sein müsse:
Die ordentliche Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum durch den Vermieter wegen schuldhafter nicht unerheblicher Vertragsverletzung des Mieters (§ 573 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB) setzt nicht eine Abmahnung des Mieters durch den Vermieter voraus. Allerdings kann der Abmahnung für die Kündigung ausnahmsweise insofern Bedeutung zukommen, als erst ihre Missachtung durch den Mieter dessen Vertragsverletzung das für die Kündigung erforderliche Gewicht verleiht.
Fristlose Kündigung erfordert Abmahnung oder gleichwertige Erinnerung
Verkürzt gesagt bedeutet das, dass eine Abmahnung dann erforderlich sein dürfte, wenn dem Verstoß oder den Verstößen an sich kein erhebliches Gewicht zukommt und erst die Missachtung der Abmahnung, die den Mieter ja an die Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten erinnern soll, zu einer nicht unerheblichen Vertragspflichtverletzung führt. Eine generelle Grenze wann eine Abmahnung erforderlich ist oder nicht, kann so nicht gezogen werden, es kommt auf den konkreten Einzelfall an. Aber: Für die fristlose Kündigung wird schon von Gesetzes wegen in der Regel eine Abmahnung oder eine gleichwertige Erinnerung erforderlich sein, vergleiche § 543 BGB, da die Folgen für den betroffenen Mieter ungleich härter sind.
Abwehr der Abmahnung durch den Mieter
Nach einer Entscheidung des BGH zur Abmahnung durch den Vermieter ist klargestellt, dass die Abmahnung als notwendiger Hinweis zwar erforderlich sein kann, andererseits dem Mieter keine eigenständigen Abwehrrechte gibt. Der Vermieter muss im Fall einer Kündigung die Tatsachenbehauptungen in der Abmahnung voll beweisen.
